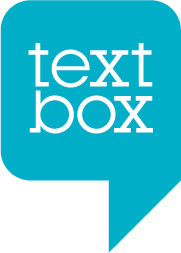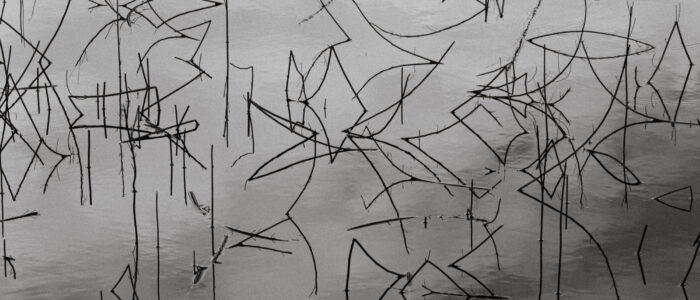Der Wurm schmeckt der Angler*in
Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, lautet eine alte Marketing-Weisheit. Wer seine Kunden auf Augenhöhe ansprechen und sie zum Dialog einladen will, sollte sich nach deren Vorlieben richten. Was die Gendersprache betrifft, setzen sich viele Unternehmen über die Marketingeinsicht hinweg. Die Analyse des kommunikativen Aspekts zeigt, wo der Haken ist.
Je nach Umfrage lehnen zwei Drittel bis drei Viertel der Menschen in Österreich und Deutschland die Gendersprache mit Sonderzeichen oder Sprechpausen ab. Dennoch stellen immer mehr Unternehmen ihre Websites und Werbemaßnahmen auf die Gendersprache um – in der Meinung, dadurch zeitgemäß, inklusiv und „divers“ zu wirken. Dabei könnten die Firmen ganz einfach auf die Kommunikationsvorlieben aller ihrer Kunden eingehen, also auch jener, die Genderstern & Co. aus sprachlichen Gründen ablehnen.
Drei Viertel bevorzugen die konventionelle Sprache
Der Freiburger Politikwissenschaftler Sebastian Jäckle hat in einer 2022 publizierten Studie untersucht, wie die Menschen politisch ticken, die Gendersprache ablehnen. Die Datenbasis bildete eine Online-Befragung, an der über 10.000 Menschen in Deutschland teilnahmen. Das Studiendesign hatte eine Besonderheit: Weil direkte Fragen zum Gendern oft zu verfälschten Ergebnissen führen, wurde die Befragung als „Online-Umfrage zu politischen Einstellungen unterschiedlicher Generationen“ ausgegeben. Und die Probanden mussten wählen, ob sie eine mit Stern gegenderte Version des Fragebogens oder eine konventionelle, „ungegenderte“ Version ausfüllen wollten. Sie wussten nicht, dass dies bereits Teil der Untersuchung war. Auf diese Weise konnte die faktische Einstellung gegenüber der Gendersprache weitgehend unverfälscht erhoben werden.
Wenig überraschend hat sich eine deutliche Mehrheit für die konventionelle Sprachform entschieden:
- Gut 75 % der Studienteilnehmer füllten den ungegenderten Fragebogen aus,
- 21 % wählten den gegenderten Fragebogen,
- knapp 4 % haben diese Hürde und damit die Teilnahme verweigert.
Es zeigte sich, dass in jeder der untersuchten Kategorien – Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Stadt- oder Landbewohner – die konventionelle Sprache eindeutig bevorzugt wird.
Bei den politischen Präferenzen zeigte sich: Gendergegner sind nicht zwingend rechts, und wer die Gendersprache ablehnt, hat nicht automatisch etwas gegen das politische Ziel Gleichberechtigung oder gegen die Anerkennung nonbinärer Geschlechtsidentitäten. In dieser Beziehung gibt es entgegen der ursprünglichen Annahme keine Kausalität!
Im Gegenteil: In der deutschen Bevölkerung herrscht überraschend breiter Konsens, was die Anerkennung von queeren Lebensentwürfen betrifft. Das ergab eine weitere aktuelle sozialwissenschaftliche Studie, „Triggerpunkte“, die sich 2023 den Konfliktarenen in der deutschen Gesellschaft widmete. Demnach haben über 80 % der Deutschen kein Problem mit Transpersonen oder der rechtlichen Gleichstellung homosexueller Partnerschaften. Dennoch ist die Gendersprache ein „Triggerpunkt“, der deutliche Ablehnung hervorruft.
Wer also greift freiwillig zu gegenderten Texten?
Der überraschende Zusammenhang, der aus den Daten der Onlinebefragung von Sebastian Jäckle errechnet werden konnte, war folgender: Die Gendervariante seines Fragebogens wurde erst dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Personen aus dem linken Parteienspektrum gewählt, wenn diese autoritär eingestellt waren. „Während auch sehr links-ökologisch-alternative Personen, sofern diese staatliche Eingriffe ablehnen, so gut wie nie die Variante mit Genderstern wählen würden, erhöht sich deren Wahrscheinlichkeit, die geschlechtergerechte Version des Fragebogens anzuklicken, auf 70 % für Männer und 75 % für Frauen, sofern sie eine maximale Zustimmung zu staatlichen Eingriffen aufweisen“, heißt es in der Zusammenfassung der Studie.
Mit anderen Worten: Die Gendervariante des Fragebogens wurde erst dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von politisch links stehenden Personen gewählt, wenn diese positiv gegenüber regulativen staatlichen Eingriffen eingestellt waren. (Umgekehrt ist zu beobachten, dass sich unter den aufgeklärten Gegnern der Gendersprache auffällig viele Autoren und Intellektuelle finden, die in der DDR aufwuchsen und sich beim Gendern an den Sprachduktus der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erinnert fühlen, wie die Schriftsteller Eugen Ruge und Monika Maron oder der Lektor Ingo Meyer.)
Gendersprache als Triggerpunkt
Dass Gendergegner nicht zwingend rechtskonservativ sind, und dass, wer die Gendersprache ablehnt, nicht automatisch etwas gegen das politische Ziel Gleichberechtigung oder gegen die Anerkennung nonbinärer Geschlechtsidentitäten hat, geht auch aus einer repräsentativen deutschen Studie von Steffan Mau et al. (2023) hervor. In „Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“ werden vier verschiedene soziale „Konflikt-Arenen“ untersucht, die sich auf die Themen soziale Klassen, Migration, Klima und Identität beziehen. Was die Anerkennung von queeren Lebensentwürfen (Thema Identität) betrifft, überrascht das Ergebnis positiv: Demnach finden es 80 % der Deutschen gut, dass Ehen für gleichgeschlechtliche Paare rechtlich möglich sind, und 84 % der Befragten geben an, kein Problem mit Transpersonen zu haben. Fazit: „Die Normen der rechtlichen Gleichstellung, der Nicht-Diskriminierung oder der permissiven Toleranz gegenüber sexueller Vielfalt sind in Deutschland breit geteilter Konsens und keine Punkte, an denen sich die Gesellschaft im Sinne eines Kulturkampfs spaltet.“ Dennoch sei die Gendersprache ein „Triggerpunkt“, der deutliche Ablehnung hervorruft.
„Gendergerechte Sprache gilt als spaltendes Thema, das sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Gegnerinnen leidenschaftliche Reaktionen hervorruft.“ Gleich wie Jäckles Untersuchung hat auch „Triggerpunkte“ ergeben, dass es in Deutschland keine Gesellschaftsgruppe gibt, die Gendersprache mehrheitlich als probates Mittel der gesellschaftlichen Emanzipation betrachtet. Weder unter den Jungen noch unter den höher Gebildeten noch unter den Frauen, ja nicht einmal unter den Frauen in Wissensberufen findet sich eine Mehrheit, die Genderdeutsch als wirkungsvolle Kommunikationsform sieht.
Daten fehlen noch
Was bedeutet das nun für die Unternehmenskommunikation nach außen und die Öffentlichkeitsarbeit der Parteien? Welche Auswirkung könnten prononcierte Genderformen wie der Genderstern oder der Gender-Doppelpunkt auf die Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen bzw. potenziellen Wählern und Parteien haben? Und wie ist es zu beurteilen, dass Gendern von einer Untergruppe tendenziell autoritär eingestellter Menschen aus dem linken Spektrum gutgeheißen wird, von der großen Mehrheit aber nicht? – Scharf konturierte Antworten darf man sich auf diese Fragen nicht erwarten, solange es keine Daten gibt, wie sich Gendertexte im Vergleich zu konventionell verfassten Texten auf Userzahlen und Verweildauer von Webpages oder auf die Wahrnehmung von Marken bzw. Parteien auswirken. Für eine erste Eingrenzung des Problemfeldes ist es aber nützlich zu wissen, warum forcierte Genderformen mit Sonderzeichen auf breiter Basis abgelehnt werden.
Die Kritikpunkte an der Gendersprache lassen sich in drei Gruppen teilen:
- Linguistische Argumente: Gendern fußt auf einem Sprachverständnis, das auf die Wortebene fixiert ist und ignoriert, wie wir sprachliche Informationen aufnehmen – nämlich kontextbasiert und prozesshaft.
- Pragmatische Argumente im Hinblick auf Verständlichkeit und Nützlichkeit: Gendersprache ist schwerer verständlich. Ihre Nützlichkeit ist mehr als fraglich.
- Kommunikative Probleme: Gendersprache erzeugt dissonante kommunikative Botschaften und führt ins Dilemma der „exklusiven Inklusion“.
.*.*.
Weiterlesen im Buch Die Sterne sehen heut‘ sehr anders aus