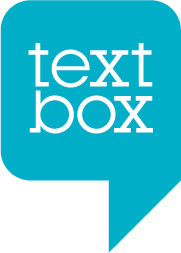Über Identitätstheorien labern
Gibt es richtige Literatur im falschen Proseminar? – Eher nein, wenn man vom Roman „Identitti“ ausgeht, der den postkolonialen Diskurs in Deutschland zum Thema hat. Plus: eine Entgegnung auf Moritz Baßler.
In der bildenden Kunst haben sich politische Themen in den vergangenen Jahren einen Fixplatz ergattert, wie die Werke von Ai Weiwei bezeugen; in den Programmen der Literaturverlage tauchen explizit politische Romane bislang nur vereinzelt auf. Der Erstling „Identitti“ der deutschen Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal ist so ein rarer Fall. Auf den über 400 Seiten des Buches wird die postkoloniale Kernfrage abgehandelt, wie sehr Hautfarbe und Herkunft unser Leben prägen. Die Hypothese: „Identität bestimmt nicht die Dinge, die wir tun, sehr wohl aber die Dinge, die andere Menschen uns antun.“ Und es wird vor allem die Frage verhandelt, ob es legitim ist, dass sich eine weiße Deutsche als farbige Deutsche ausgibt. Verschärft wird dieses akademische Problem dadurch, dass es sich bei der fraglichen Figur in Sanyals Roman um die führende Intellektuelle der postkolonialen Studien in Deutschland handelt, die sich nach der indischen Göttin der Weisheit Saraswati nennt, aber im bürgerlichen Leben Sarah Vera Thielmann heißt.
Verheißungsvoller Plot, enttäuschende Umsetzung
Während die Community nach dem Outing der Düsseldorfer Professorin als – Gottseibeiuns – Weiße einen Shitstorm über die Frau ergießt, versucht ihre Studentin Nivedita, die sich als Bloggerin Identitti nennt, herauszufinden, was in aller Welt ihr Idol Saraswati dazu getrieben hat, sich als falsche Inderin auszugeben und zu einer Wortführerin der deutschen „People of Color“-Bewegung aufzuschwingen.
So verheißungsvoll dieser Plot über moderne Identitätsverwicklungen in seinen Grundzügen klingt, so zäh ist die literarische Umsetzung im Buch. Das liegt einerseits an den theorielastigen Dialogen, mit denen der Fall Saraswati abgehandelt wird, und viel mehr noch an den klischeehaften Figuren, die im Lauf der Geschichte nicht elementar an Tiefe gewinnen: Da ist die verwirrte deutsche Halb-Inderin Nivedita, die an der Trennung von ihrem nerdigen Freund Simon laboriert und unentwegt mit der Göttin Kali Zwiesprache hält; da ist die selbstbewusste englische Halb-Inderin Priti, die zum Studieren nach Deutschland gekommen ist und den Fall ins Rollen bringt; da ist weiters die trotzige deutsche Halb-Afrikanerin Oluchi, die Saraswati canceln möchte, und da ist schließlich die pseudoindische lesbische Star-Professorin, die sich alles wortreich zurechtbiegen kann. Kurz: Wer mit identitätspolitischen Spitzfindigkeiten gerne seine Stunden verbringt, für den könnte „Identitti“ unterhaltsam sein; alle anderen Menschen werden das Buch irgendwann gelangweilt zur Seite legen.
Mühsame Diskurse mit poppigem Anstrich
Wie in der Kunst ist auch in der Literatur kaum etwas zermürbender als ideologische Diskurse, die oberflächlich mit einem ästhetisierenden Anstrich versehen werden. In „Identitti“ besteht diese Lasur aus einer flapsigen Ich-Erzählung, wie sie seit den 1990ern als typisch für den deutschen Pop-Roman gelten kann, angereichert um Blogtext-Einschübe Niveditas und Zitate vom digitalen Twitter-Pranger, wo Saraswatis Fall in kurzen, polemischen Textnachrichten verhandelt wird.
„Identitti“ ist in diesem Sinn weniger ein Roman als vielmehr ein als Literatur deklariertes, fiktives Proseminar über die Theorien und Probleme der postkolonialen Studien in Deutschland und dem Rest der Welt, denn die im Roman abgehandelten Auseinandersetzungen folgen allesamt realen Vorbildern. In den frühen 1970ern hätte man in einem entsprechenden Werk mit voller Hingabe die Grabenkämpfe zwischen Maoisten und Trotzkisten in der Hochschülerschaft verhandelt. Wen’s erbaut … Für Außenstehende ist „Identitti“ schlicht lähmend, so als würde man sich an der Uni in eine falsche (Be-)Lehrveranstaltung verirren. Da hilft auch der Handapparat am Ende nichts, wo die wichtigsten Argumente der postkolonialen Rassismusdiskurse ihren realen „Urheber*innen“ zugeordnet werden.
Post Skriptum: Entgegnung auf Moritz Baßler
Die Rezension erschien im Februar 2021 in der „Wiener Zeitung“ und war anscheinend der einzige Verriss des ansonsten hochgelobten Buches. Der Germanist Moritz Baßler erwähnt diese Rezension in seinem Buch „Populärer Realismus“ (C. H. Beck, 2022) und meint, meine Kritik, die Figuren gewönnen nicht elementar an Tiefe, könne „falscher nicht sein“; denn der Roman wisse, „dass die ‚Tiefe‘ von Figuren in der Gegenwart ganz wesentlich in ihren Spuren, ihrem Echo und ihren Facetten in den Medien und den entsprechenden Gemeinschaften liegt; und genau das gestaltet Sanyal in einer Komplexität, wie sie bisher in der deutschen Literatur unbekannt war.“
Baßler hat Recht, dass Sanyal eine Gegenwart abbildet, wo es nicht mehr auf den Charakter ankommt, sondern auf Identitätszuschreibungen, die man von sich in die Spiegelkabinette der digitalen Medien schickt. Aber so leichtfertig wie der Germanist möchte ich die vielschichtige Charakterzeichnung von Figuren, die ich im Roman vermisse, nicht auf der Müllhalde der Literaturgeschichte entsorgt sehen, denn das hieße, eine oberflächliche Gegenwart zu bejubeln.
Verglichen etwa mit Philipp Roths „Der menschliche Makel“ aus dem Jahr 2000, wo ähnliche Motive verhandelt und vergleichbare Milieus beschrieben werden wie in „Identitti“, sind Sanyals Figuren bar jeder individuellen Regung. Wenn sie etwas sagen, bloggen oder twittern, dann sind das Sprechblasen und Empörungsbekundungen der woken Identitätspolitik bzw. gelehrte Repliken darauf. Dass sogar diese Art diskurslastige Schreibe eine Spur spritziger gehen kann, zeigte Thomas Meinecke bereits 1998 mit seinem Roman „Tomboy“, der die damals brandheißen akademischen Diskussionen um die „Gender Troubles“ von Judith Butler ähnlich theorielastig, aber in der Figurenzeichnung dennoch deutlich plastischer abhandelt.
Es war wohl auch schon vor den sozialen Medien und dem Web 2.0 so, wie es in „Identitti“ dargestellt wird, dass die meisten Leute nichts Eigenes zu sagen haben und stattdessen mit umso größerem Nachdruck Sprechblasen bedienen. Nur, und damit muss ich Baßler deutlich widersprechen: Die 1:1-Nachbildung dieses geistigen Nullsummenspiels ist aus meiner Sicht keine besondere ästhetische Leistung. Eine universitäre Blase mit ihren akademischen Floskeln wiederzugeben, ergibt für mich per se keinen guten Roman. Den Hype um „Identitti“ halte ich für ein Modephänomen.
Mithu Sanyal: Identitti. Roman. Carl Hanser Verlag: München 2021, 434 Seiten