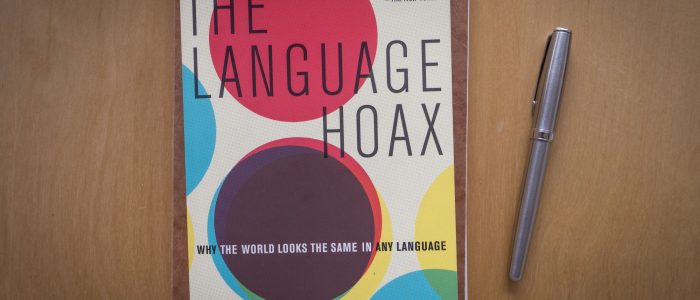Das Weltsicht-Märchen
Wie groß ist der Einfluss der Sprache auf unser Denken? – John McWhorter von der Columbia-Universität in New York fasst in seinem Buch „The Language Hoax“ (frei übersetzt: „Der Sprach-Hokuspokus“) die Erkenntnisse aus aktuellen psycholinguistischen Untersuchungen zusammen, vergleicht sie mit Sprachstrukturen rund um den Globus und erteilt der populären Idee eine Absage, dass Sprachen die Weltsicht ihrer Sprecher formen.
Dass Sprache Auswirkungen auf die Wahrnehmung hat, ist erwiesen – allerdings in einem höchst bescheidenen Ausmaß. So konnten beispielsweise Russen, die mit goluboj ein eigenes Wort für Hellblau haben und mit siniji eines für Dunkelblau, in psychologischen Tests verschiedene Blauschattierungen schneller erkennen als Englischsprachige. Der Unterschied betrug im Schnitt – man halte sich fest! – 124 Millisekunden. Eine unterschiedliche Weltsicht lasse sich daraus nicht ableiten, meint der Linguist John McWhorter, Professor an der Columbia-Universität in New York.
Lange Nacht oder große Nacht?
Auch mache es einen gewissen Unterschied, ob man in einer Sprache von einer „langen Nacht“ spreche (wie auf Englisch oder Deutsch) oder die Zeitdauer mit dem Begriff eine „große Nacht“ zum Ausdruck bringe, wie es Spanisch oder Griechisch tun. Psychologische Experimente haben gezeigt, dass die einen mit der „langen Nacht“ eine Spur besser abschätzen können, wann ein bewegter Gegenstand sein Ziel erreicht. Und die mit der „großen Nacht“ können eine Spur besser abschätzen, wann sich ein Kasten mit Wasser gefüllt haben wird. Auch hier sind die messbaren Unterschiede so minimal, dass nichts auf eine eigene „Weltsicht“ der jeweiligen Sprecher hinweist.
Kultur formt Sprache, nicht umgekehrt
McWhorter zählt etliche Experimente und Untersuchungen der Kognitionspsychologie und Linguistik auf. Und er vergleicht mit viel Enthusiasmus grammatische Strukturen von weltumspannenden Sprachen mit solchen, die in Nordamerika, Australien, Neuguinea oder im Amazonasdschungel von jeweils ein paar Tausend Menschen gesprochen werden. Dabei kommt er zum Schluss: Die Struktur einer Sprache (= die Grammatik) korreliert nicht aussagekräftig mit der Kultur der Sprecher. Zwar formt die Kultur die Sprache zu einem gewissen Ausmaß, zum Beispiel im Wortschatz; aber umgekehrt lässt sich nicht erkennen, dass die Sprache die Kultur forme. Denn: „Culture and language structure–that is, thought and language structure–do not match.“ (Kultur und Grammatik – also Gedanken und Grammatik – decken sich nicht.)
Rehabilitation für „primitive“ Völker
Dass die Ergebnisse aus den psycholinguistischen Experimenten in den Medien oft verkürzt dargestellt und gerne in die Richtung „Sprache prägt die Weltsicht“ interpretiert werden, führt McWhorter auf ein romantisches Bedürfnis zurück. Einerseits wirkt die Welt viel interessanter, wenn man weiß, dass sie sich auch anders sehen lässt. Und andererseits wollte der Gründer der linguistischen Weltsicht-Theorie, Benjamin Lee Whorf, mit seinen Untersuchungen der Hopi-Sprache in den 1930ern auch zeigen, dass die Indigenen nicht die primitiven Wilden sind, als die sie jahrzehntelang von den weißen Amerikanern dargestellt wurden. Dieses Anliegen ist unterstützenswert. Und viele Psychologen und Linguisten, die heute auf den Spuren Whorfs wandeln, handeln nach wie vor aus den besten Absichten. Das Problem ist nur: Wenn man die komplexe Sprachstruktur eines indigenen Volkes als Hinweis auf eine komplexe Weltsicht nimmt, was müsste man dann aus der relativ einfachen Grammatik des Mandarin und verwandter Sprachen schließen? Dass die Gedanken von über einer Milliarde Südostasiaten viel simpler gestrickt sind als von jenen, die eine indoeuropäische Sprache sprechen? Überlegungen auch in diese Richtung gab es bereits: Im späten 19. Jahrhundert wurden vom deutschen Historiker und Proto-Antisemiten Heinrich von Treitschke sprachliche Unterschiede mit damaligen rassentheoretischen Ausführungen verknüpft, wie McWhorter erwähnt. Kein Vorbild, dem man nacheifern sollte. Zumal es die wissenschaftliche Faktenlage auch gar nicht zulässt.
Mit „The Language Hoax“ erteilt John McWhorter sämtlichen Bestrebungen, Sprache und Weltsicht als voneinander abhängig darzustellen, eine eindeutige Absage. Der Untertitel seines Buches – „Why the World Looks the Same in Any Language“ – ist eine direkte Entgegnung auf Guy Deutschers populäres Buch „Through the Looking Glass. Why the World Looks Different in Other Languages“ aus dem Jahr 2011 (Dt.: „Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht“). Grammatische Unterschiede drücken nicht verschiedene Weltsichten aus, so McWhorter, sondern sind das Resultat von purem Zufall. Dass die Grammatik Einfluss auf die Kultur habe, lasse sich, wenn man genau hinsehe, nirgendwo beobachten.
Das generische Femininum im Amazonas-Dschungel
Für Deutschsprachige ist McWhorters Erkenntnis vor allem vor dem Hintergrund der Gendersprache interessant. Der Fleißaufgabe des Genderdeutsch wird ja deshalb so ausführlich gefrönt, weil die Sprache unsere Sicht auf Geschlechterrollen beeinflusse, wie es heißt, und weil „geschlechtergerechtes“ Sprechen zur Geschlechtergerechtigkeit beitrage. Ein Irrtum. McWhorter weiß beispielsweise von den Amazonas-Völkern Jarawara und Banawá zu berichten, in deren Sprachen ein generisches Femininum gebildet werde – und wo Frauen gleich rüde behandelt werden wie bei vielen anderen Häuptlingsgesellschaften, die das generische Maskulinum verwenden. (Nebenbei: Mandarin, Türkisch und Ungarisch kennzeichnen das Genus nicht. Dass die Frauen in diesen Ländern deshalb mehr gesellschaftlichen Einfluss hätten als anderswo, kann man nicht beobachten.)
Sprache entwickelt sich nicht logisch
Grammatik entwickle sich nicht aus irgendwelchen kulturellen Logiken oder Herrschaftsverhältnissen heraus, meint McWhorter, sondern rein zufällig. Die Weltsicht einer Kultur werde nicht von der Grammatik ihrer Sprache beeinflusst, sondern von Argumenten, die man in der Sprache zum Ausdruck bringt. „In the real world, language talks about the culture; it cannot create it.“ (Im echten Leben spricht die Sprache über die Kultur; sie kann sie nicht hervorbringen.)
Lustvolles Plädoyer dafür, die Kirche im Dorf zu lassen
Das brillant geschriebene, lustvoll aus den Zwischentönen von Wortfeldern schöpfende Buch „The Language Hoax“ schließt mit einem Plädoyer. Man solle, meint McWhorter, die faszinierenden Unterschiede zwischen den derzeit (noch) existierenden 6000 Sprachen anerkennen, darf sie aber weder überbewerten noch sollte man sie mit ethnologischen oder psychologischen Zuschreibungen verknüpfen. Denn die Sprachen dieser Erde seien in ihrer Vielfalt Ausdruck des einen menschlichen Geistes, der alle Völker und Menschen miteinander verbindet. Der Himmel ist für alle gleich blau, egal wie viele Wörter man dafür hat, und die Nacht für alle gleich lang, auch wenn die Dauer als „groß“ angegeben wird.
John McWhorter: The Language Hoax. Why the World Looks the Same in Any Language. Oxford University Press: New York 2014. 182 Seiten.
Hinweis: In einem Vortrag am Santa Fe-Institut führt McWhorter einige der Thesen aus, die er in seinem Buch beschreibt. Man kann den Vortrag auf Youtube nachsehen.